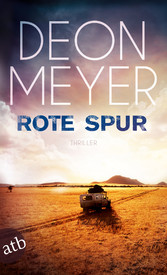Suchen und Finden
1
(31. Juli 2009. Freitag.)
Ismail Mohammed rannte die steil abfallende Heiligerlaan hinunter. Seine weiße Galabija mit dem modernen, offenen Mandarin-Kragen bauscht»Kommt«, sagte er ruhig. »Alles hat siche sich bei jedem seiner Schritte auf. Er ruderte hektisch mit den Armen, aus Angst und um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Die gehäkelte Kufi fiel ihm vom Kopf und blieb auf den Pflastersteinen neben der Kreuzung zurück. Seine Augen waren starr auf die Stadt dort unten gerichtet, wo er einigermaßen in Sicherheit sein würde.
Hinter ihm flog die Tür des weißen, eingeschossigen Hauses neben der Schotsekloof-Moschee oben im Bo-Kaap ein zweites Mal auf. Sechs Männer, ebenfalls in traditionellen muslimischen Gewändern, stürmten auf die Straße und blickten alle instinktiv bergab. Einer hielt eine Pistole in der Hand. Hastig zielte er auf den flüchtenden Ismail Mohammed, der bereits sechzig Meter weit entfernt war, und schoss zwei Mal auf gut Glück, bis der ältere Mann hinter ihm von unten gegen seinen Arm schlug und rief: »Nein! Los, ihm nach!«
Die drei Jüngeren nahmen die Verfolgung auf. Die Älteren blieben zurück, besorgt über Ismails Vorsprung.
»Du hättest auf ihn schießen lassen sollen, Scheich«, sagte einer.
»Nein, Shahid. Er hat uns belauscht.«
»Genau. Und dann ist er geflohen. Das sagt doch alles.«
»Aber nicht, für wen er arbeitet.«
»Er? Ismail? Du glaubst doch wohl nicht …«
»Man kann nie wissen.«
»Nein. Er ist zu … ungeschickt. Höchstens für einen der nationalen Geheimdienste. Die NIA vielleicht.«
»Ich hoffe, du hast recht.« Der Scheich sah den Verfolgern
nach, die über die Kreuzung Chiappinistraat sprinteten, und versuchte, die Tragweite des Zwischenfalls zu ermessen. Plötzlich heulte knapp unter ihnen, in Buitengracht, eine Sirene auf.
»Kommt«, sagte er ruhig. »Alles hat sich geändert.«
Er eilte ihnen voraus zum Volvo.
Eine weitere Sirene setzte ein, unten im Herzen der Stadt.
Sie wusste, was die zielstrebigen, eiligen Schritte an einem Freitagnachmittag
um fünf bedeuteten. Erfüllt von einer lähmenden, bedrückenden Vorahnung, versuchte sie schweren Herzens, sich zu wappnen.
Barend stürmte herein, umweht von einem Duft nach Shampoo und übermäßig viel Deodorant. Sie sah ihn nicht an. Sie wusste, dass er sich für den Abend gestylt und mit seiner neuen, ungewohnten Frisur herumexperimentiert hatte. Er setzte sich an die Küchentheke. »Na, wie geht’s dir, Mama? Was machst du so?« Richtig jovial.
»Abendessen«, erwiderte Milla gelassen.
»Ach so. Ich esse aber nicht mit.«
Sie hatte es geahnt. Christo würde sicher auch nicht kommen. »Du brauchst doch bestimmt heute Abend dein Auto nicht, oder, Mama?«, fragte er in einem Tonfall, den er bis zur Perfektion vervollkommnet hatte: eine raffinierte Mischung von vorausschauender Gekränktheit und implizitem Vorwurf.
»Wo wollt ihr denn hin?«
»In die Stadt. Jacques kommt mit. Er hat einen Führerschein.«
»Wohin in der Stadt?«
»Wissen wir noch nicht genau.«
»Ich will es aber wissen, Barend«, erwiderte sie so sanft wie
möglich.
»Okay, Mama, ich sag dir dann Bescheid.« Die ersten verärgerten Untertöne.
»Wann seid ihr wieder da?«
»Mama, ich bin achtzehn. In meinem Alter war Papa schon in der Armee.«
»Ja, aber auch da gab es Regeln.«
Er seufzte gereizt. »Okay, okay. Sagen wir … wir machen uns um zwölf auf den Heimweg.«
»Das hast du letzte Woche auch versprochen und bist dann erst nach zwei nach Hause gekommen. Du musst dich auf dein Examen vorbereiten, die Klausuren sind …«
»Mein Gott, Mama, musst du mir das immer wieder aufs Butterbrot schmieren? Gönnst du mir denn gar nichts?«
»Doch, ich gönne dir alles. Aber innerhalb gewisser Grenzen.«
Er antwortete mit gedämpftem Hohngelächter, das ausdrückte, was sie doch für eine blöde Kuh sei und dass er sie kaum ertrage. Sie zwang sich, nicht darauf einzugehen.
»Wie gesagt: Wir fahren um zwölf Uhr los.«
»Und bitte trinkt keinen Alkohol.«
»Was machst du dir denn darüber Sorgen?«
Weil ich eine halbe Flasche Brandy in deinem Kleiderschrank gefunden habe, ungeschickt hinter den Unterhosen versteckt, und dazu eine Schachtel Marlboro, dachte sie bei sich. »Es ist meine Aufgabe, mir Sorgen zu machen. Du bist mein Sohn.«
Schweigen. Das schien er zu akzeptieren. Sie fühlte sich erleichtert. Er hatte also bekommen, was er wollte. Bis hierher hatten sie es ohne Auseinandersetzung geschafft. Dann hörte sie das rhythmische Klopfen seines wippenden Beins gegen die Theke und sah, wie er mit dem Deckel der Zuckerdose spielte. Da wusste sie, dass es noch nicht genug war. Er wollte auch noch Geld von ihr.
»Mama, ich möchte nicht, dass Jacques und die anderen für mich bezahlen.«
Er wählte seine Worte derart mit Bedacht, steigerte seine Forderungen so geschickt, pirschte sich mit einer Strategie aus Anschuldigungen und Vorwürfen an sie heran. Er spinnt sein Netz planvoll wie ein Erwachsener, dachte sie. Er stellte seine Fallen auf, und sie tappte jedes Mal hinein, nur weil sie um jeden Preis Konflikte vermeiden wollte. Ihre Stimme verriet, dass sie bereits in die Defensive ging. »Hast du nichts mehr von deinem Taschengeld übrig?«
»Willst du, dass ich wie ein Schmarotzer dastehe?«
Das »Du« und die Aggressivität waren die Auslöser – sie ahnte das vertraute Streitmuster voraus. Sie sollte ihm einfach das Geld geben, ihr Portemonnaie in die Hand drücken und sagen: Hier! Nimm alles! So viel du willst!
Sie atmete tief durch. »Ich möchte, dass du dir dein Taschengeld besser einteilst. Achthundert Rand im Monat sind doch wirklich …«
»Weißt du, wie viel Jacques bekommt?«
»Das spielt keine Rolle, Barend. Wenn du mehr haben möchtest, musst du …«
»Willst du, dass ich alle meine Freunde verliere? Du gönnst mir auch überhaupt nichts, verdammte Scheiße!« Der Fluch und der Knall des Zuckerdosendeckels, den er gegen den Schrank warf, ließen sie zusammenzucken.
»Barend«, sagte sie entsetzt. Schon oft war er explodiert, hatte die Hände in die Luft geworfen, vor sich hin geflucht und feige, knapp außer Hörweite, etwas unsagbar Ordinäres gemurmelt, doch diesmal nicht. Diesmal beugte er den Oberkörper über die Theke, das Gesicht vor Verachtung verzerrt, und sagte: »Du machst mich krank.«
Sie wich zurück, als hätte er sie körperlich angegriffen, und musste sich am Schrank festhalten. Sie wollte nicht weinen, aber die Tränen liefen ihr übers Gesicht, dort am Ofen, mit dem Kochlöffel in der Hand, den Duft von warmem Olivenöl in der Nase. Wieder stammelte sie den Namen ihres Sohnes, beruhigend und sanft.
Voller Bosheit und Verachtung und in der vollen Absicht, sie zu verletzen, mit der Stimme, dem Tonfall und der demütigenden Art seines Vaters sank Barend zurück auf den Hocker und stieß hervor: »Mein Gott, bist du armselig. Kein Wunder, dass dein Mann mit anderen bumst.«
Das Mitglied des Kontrollausschusses, ein Glas in der Hand, winkte Janina Mentz zu. Sie blieb stehen und wartete, bis der Mann sich zu ihr durchgedrängt hatte. »Frau Direktor«, begrüßte er sie, neigte sich zu ihr und näherte seinen Mund verschwörerisch dicht ihrem Ohr. »Haben Sie schon gehört?«
Sie standen in der Mitte des Bankettsaals, umgeben von vierhundert Gästen. Sie schüttelte den Kopf, in Erwartung des Skandälchens der Woche.
»Der Minister erwägt eine Fusion.«
»Welcher Minister?«
»Ihr Minister.«
»Eine Fusion?«
»Die Gründung einer Dachorganisation. Sie, der Nationale Nachrichtendienst NIA, der Geheimdienst, alle gemeinsam. Eine Vereinigung, eine Zusammenlegung. Allgemeine Integration.«
Sie sah ihn an und untersuchte sein vom Alkohol gerötetes Vollmondgesicht auf Zeichen von Humor. Vergeblich.
»Ach was«, sagte sie. Der war doch nicht mehr ganz nüchtern?
»So geht das Gerücht. Ein ziemlich hartnäckiges.«
»Wie viel haben Sie getrunken?«
»Janina, das ist mein voller Ernst.«
Sie wusste, dass er stets gut informiert war und man sich bisher immer auf ihn verlassen konnte. Wie gewohnt verbarg sie ihre Besorgnis. »Besagt das Gerücht auch, wann?«
»Der offizielle Beschluss wird in drei, vier Wochen erwartet. Aber das ist noch nicht alles.«
»Nein?«
»Der Präsident will Mo haben. Als Chef.«
Sie sah ihn nur stirnrunzelnd an.
»Mo Shaik«, präzisierte er.
Sie lachte, kurz und skeptisch.
»Man hört es immer wieder«, beharrte er voller Ernst.
Sie lächelte und wollte ihn gerade nach seiner Quelle fragen, als das Handy in ihrer schwarzen Abendhandtasche klingelte. »Entschuldigen Sie«, sagte sie, öffnete die Handtasche, holte das Telefon heraus und sah, dass es der Anwalt war.
»Tau?«, fragte sie.
»Ismail Mohammed hat kalte Füße bekommen.«
Milla lag in der Dunkelheit, auf der Seite, mit angezogenen Beinen. Nachdem sie sich ausgeweint hatte, musste sie widerwillig einigen schmerzlichen Wahrheiten ins Gesicht sehen. Es war, als sei das Rauchglas, die getönte Scheibe zwischen ihr und der Realität, plötzlich zerbrochen, so dass sie ihr jetziges Dasein im hellen Licht betrachten musste und nicht mehr wegsehen konnte.
Als sie ihren eigenen Anblick nicht mehr ertrug, begann sie, ihren Zustand zu analysieren. Rückblickend versuchte sie nachzuvollziehen, wie sie an diesen Punkt gekommen war. Wie hatte sie derart abstumpfen und so tief...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.