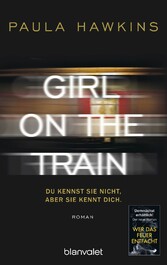Suchen und Finden
RACHEL
Freitag, 5. Juli 2013
Morgens
Da liegt ein Kleiderhaufen an den Gleisen. Hellblauer Stoff – vielleicht ein Hemd –, verknäuelt mit etwas schmutzig Weißem. Wahrscheinlich ist es nur Abfall, irgendwas aus einem Müllsack, der heimlich in das zugewucherte Waldstück oben am Bahndamm geschleudert wurde. Oder die Sachen wurden von einem der Arbeiter dort liegen gelassen, die an dem Streckenabschnitt beschäftigt sind. Schließlich sind sie oft genug hier. Vielleicht war es aber auch ganz anders. Meine Mutter meinte immer, ich hätte eine zu lebhafte Fantasie; Tom meinte das auch. Aber ich kann einfach nicht anders, ich sehe ein paar liegen gebliebene Fetzen, ein schmutziges T-Shirt oder einen Schuh und muss sofort an den zweiten Schuh denken und an die Füße, die daringesteckt haben.
Der Zug ruckelt und knarzt und quietscht sich wieder in Bewegung, der kleine Kleiderhaufen verschwindet aus meinem Blickfeld, und wir rumpeln weiter auf London zu, ungefähr so schnell wie ein guter Jogger. Aus der Reihe hinter mir höre ich ein resigniertes, verärgertes Seufzen. Der Acht-Uhr-vier-Zug von Ashbury nach Euston stellt die Geduld des abgeklärtesten Pendlers auf die Probe. Theoretisch dauert die Fahrt vierundfünfzig Minuten, aber das tut sie so gut wie nie: Der Streckenabschnitt ist uralt, zerfahren, von Signalstörungen und nie endenden Reparaturarbeiten geplagt.
Der Zug kriecht dahin; er zittert an Lagerhäusern und Wassertürmen, Brücken und Schuppen vorbei, an bescheidenen viktorianischen Häusern, die den Gleisen empört den Rücken zukehren.
Ich lehne den Kopf ans Zugfenster und lasse die Häuser an mir vorbeiziehen wie bei einer Kamerafahrt. Ich sehe sie so, wie andere sie nicht sehen; wahrscheinlich sehen nicht einmal ihre Bewohner sie aus dieser Perspektive. Zweimal am Tag bieten sich mir für einen Moment Einblicke in fremde Leben. Irgendwie hat der Anblick von Fremden, die daheim in Sicherheit sind, etwas Tröstliches.
Irgendwo klingelt ein Handy mit einer unpassend fröhlichen, munteren Melodie. Der Angerufene lässt sich Zeit; es dudelt und dudelt immer weiter. Ich spüre, wie die anderen Fahrgäste auf ihren Sitzen hin und her rutschen, mit Zeitungen rascheln, auf ihre Computer eintippen. Der Zug ruckt und schwankt um eine Biegung und verlangsamt die Fahrt vor einem roten Signal. Ich versuche, nicht aufzusehen; ich versuche, die Gratiszeitung zu lesen, die mir am Eingang zum Bahnhof in die Hand gedrückt wurde, doch die Worte verschwimmen vor meinen Augen; nichts kann mein Interesse wecken. Im Geist sehe ich immer noch den kleinen Kleiderhaufen verlassen neben der Strecke liegen.
Abends
Der Fertig-Gin-Tonic sprudelt über die Öffnung, als ich die Dose an die Lippen setze und den ersten Schluck nehme. Herb und kalt, der Geschmack meines allerersten Urlaubs mit Tom im Jahr 2005 in einem Fischerdorf an der baskischen Küste. Morgens schwammen wir die halbe Meile zu der kleinen Insel in der Bucht und liebten uns dort auf geheimen, versteckten Stränden; nachmittags saßen wir in einer Bar, tranken starken, bitteren Gin Tonic und sahen den Beachfußballern zu, die bei Ebbe auf dem Sand chaotische Spiele mit Mannschaften von je fünfundzwanzig Spielern austrugen.
Ich nehme noch einen Schluck, dann noch einen; die Dose ist schon halb leer, aber das ist schon in Ordnung. In der Plastiktüte zu meinen Füßen liegen noch drei. Und weil Freitag ist, brauche ich auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich im Zug trinke. Thank God It’s Friday. Endlich Zeit für die Freuden des Lebens.
Das Wochenende soll herrlich werden, jedenfalls haben sie das angekündigt. Strahlender Sonnenschein, wolkenloser Himmel. Früher wären wir vielleicht mit einem Picknickkorb und der Zeitung in den Corly Wood gefahren, hätten den ganzen Nachmittag im getüpfelten Sonnenlicht auf einer Decke gelegen und Wein getrunken. Vielleicht hätten wir auch mit ein paar Freunden im Garten gegrillt oder uns im The Rose in den Biergarten gesetzt, bis unsere Gesichter vom Alkohol und von der Sonne geglüht hätten, und wären dann Arm in Arm nach Hause geschwankt, um auf dem Sofa einzuschlafen.
Strahlender Sonnenschein, wolkenloser Himmel und niemanden zum Spielen, nichts zu tun. So zu leben, wie ich es zurzeit tue, ist im Sommer noch schlimmer, wenn es so lang hell bleibt und die Dunkelheit so wenig Schutz bietet, wenn alle ständig unterwegs und dabei so aufdringlich, aggressiv glücklich sind. Es ist ermüdend, und man bekommt ein schlechtes Gewissen, weil man sich absondert.
Das Wochenende erstreckt sich endlos vor mir, achtundvierzig leere Stunden, die ich ausfüllen muss. Ich setze die Dose wieder an, aber es ist kein Tropfen mehr übrig.
Montag, 8. Juli 2013
Morgens
Wieder im Acht-Uhr-Vierer zu sitzen ist eine Erleichterung. Nicht dass ich es besonders eilig hätte, nach London zu kommen und die Woche in Angriff zu nehmen – eigentlich zieht mich überhaupt nichts nach London. Ich will mich nur in den weichen, durchgesessenen Velourssitz lehnen, will spüren, wie die Sonne warm durchs Fenster scheint, wie der Wagen hin und her und hin und her schaukelt, wie die Räder ihren beruhigenden Rhythmus auf die Schienen klopfen. Hier, wo ich die Häuser neben den Gleisen betrachten kann, bin ich lieber als irgendwo sonst.
Ungefähr auf der Hälfte der Fahrt ist wieder irgendein Signal defekt. Zumindest nehme ich an, dass es defekt ist, weil es praktisch immer auf Rot steht. Fast jeden Tag halten wir dort an, manchmal nur für ein paar Sekunden, manchmal für endlose Minuten. Wenn ich in Wagen D sitze, so wie meistens, und der Zug vor dem Signal anhält, so wie fast immer, habe ich den perfekten Ausblick auf mein Lieblingshaus an den Gleisen: Nummer fünfzehn.
Nummer fünfzehn sieht aus wie auch die meisten anderen Häuser an diesem Streckenabschnitt: eine viktorianische Doppelhaushälfte, zwei Stockwerke hoch, mit einem schmalen, gepflegten Garten, der nach etwa sieben Metern an einem Zaun endet. Dann folgen ein paar Meter Niemandsland, dahinter verlaufen die Gleise. Ich kenne dieses Haus mittlerweile in- und auswendig. Ich kenne jeden einzelnen Ziegelstein, ich kenne die Farben der Vorhänge im Schlafzimmer im ersten Stock (beige mit dunkelblauem Aufdruck), ich weiß, dass sich der Lack vom Fensterrahmen des Badezimmers schält und dass auf der rechten Dachseite vier Ziegel fehlen.
Ich weiß, dass die Bewohner dieses Hauses, Jason und Jess, an warmen Sommerabenden manchmal aus dem großen Schiebefenster klettern und sich auf ihre improvisierte Dachterrasse über der ausgebauten Küche im Erdgeschoss setzen. Sie sind das perfekte Paar. Er ist dunkelhaarig und gut gebaut, stark wie ein Bollwerk und dabei sanft und hat ein betörendes Lachen. Sie ist eines dieser zerbrechlichen Vögelchen, eine hellhäutige Schönheit mit einem kurz geschnittenen Blondschopf. Sie hat das richtige Gesicht für so eine Frisur: scharfe Wangenknochen, getüpfelt mit ein paar Sommersprossen, dazu ein elegantes Kinn.
Solange wir vor dem roten Signal feststecken, halte ich nach den beiden Ausschau. Jess sitzt morgens oft auf der Terrasse im Erdgeschoss, vor allem im Sommer, und trinkt Kaffee. Manchmal, wenn ich sie sehe, habe ich das Gefühl, dass sie mich ebenfalls sieht – dass sie meinen Blick erwidert –, und dann würde ich ihr am liebsten zuwinken. Jason sehe ich nicht ganz so häufig; er ist oft beruflich unterwegs. Aber selbst wenn sie nicht da sind, male ich mir aus, was sie vorhaben könnten. Vielleicht haben sie sich beide freigenommen, und sie liegt im Bett, während er ihr Frühstück macht, oder sie sind zusammen joggen, denn so was sähe ihnen ähnlich. (Tom und ich sind sonntags oft gemeinsam joggen gegangen – ich ein bisschen schneller als sonst, er ungefähr halb so schnell wie üblich, damit wir nebeneinander herlaufen konnten.) Vielleicht ist Jess aber auch oben im kleinen Zimmer und malt, oder sie stehen gemeinsam unter der Dusche, wo sie sich gegen die Kacheln stemmt und er seine Hände um ihre Taille legt.
Abends
Halb dem Fenster zugewandt und mit dem Rücken zum restlichen Wagen öffne ich eins der Chenin-Blanc-Fläschchen, die ich im Whistlestop in Euston gekauft habe. Der Wein ist zwar nicht kalt, aber das ist schon okay. Ich gieße ein bisschen was in einen Plastikbecher, schraube den Verschluss wieder zu und lasse die Flasche in meine Handtasche gleiten. Montags im Zug zu trinken ist wenig gesellschaftsfähig – es sei denn, man trinkt in Gesellschaft, aber das tue ich nicht.
Vertraute Gesichter sitzen in diesen Zügen, Menschen, die ich Woche für Woche sehe, entweder auf dem Hin- oder auf dem Rückweg. Ich erkenne sie wieder, und wahrscheinlich erkennen sie mich ebenfalls wieder. Ich weiß allerdings nicht, ob sie mich als das sehen, was ich wirklich bin.
Es ist ein strahlend schöner Abend, warm, aber nicht zu schwül, die Sonne steht erst am Beginn ihres gemächlichen Abstiegs, die Schatten werden langsam länger, und das Licht beginnt eben erst, die Bäume zu vergolden. Der Zug rattert vor sich hin, wir fliegen an Jasons und Jess’ Haus vorbei, und die beiden verschwinden in einem abendlichen Sonnenfleck. Manchmal, allerdings nicht allzu oft, sehe ich sie auch von dieser Seite der Gleise. Wenn gerade kein Zug in die entgegengesetzte Richtung fährt und wir langsam genug sind, kann ich einen Blick auf die beiden erhaschen, wie sie auf ihrer Terrasse sitzen. Wenn nicht – so wie heute –, dann stelle ich es mir einfach vor. Jess hat die Füße auf den Terrassentisch gelegt und ein Glas Wein in der Hand, während Jason hinter ihr...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.