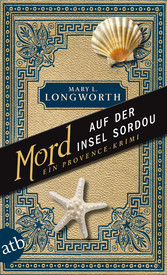Suchen und Finden
1. Kapitel
Lacydon
Vom Boot aus hatte man einen schönen Blick auf die Canebière, die schnurgerade von der Höhe bis zum alten Hafen verläuft und dabei die Innenstadt in zwei gleich große Teile trennt, als habe man mit einem Stock einen Strich durch den Sand gezogen. Es hat durchaus seine Logik, dass Marseilles Hauptstraße am Wasser endet, denn sie war einst das Bett des Flusses Lacydon. Eric Monnier presste die Hüfte an die Reling des Bootes, um seinen Zigarrenstummel wieder anzuzünden. Dabei fiel ihm auf, dass die Berge hinter der Stadt förmlich in die Höhe wuchsen, je weiter man aufs Meer hinausfuhr, als ob sie Marseille ins Wasser drängen, ja, stoßen wollten. Merkwürdig, ging es ihm durch den Sinn, wenn man in der Stadt war, fielen einem die schneeweißen Kalkberge gar nicht auf. Dort hörte man Autos hupen, Möwen schreien, roch das Meer, sah Staub und Schmutz. Er wusste, dass Marseille gar nicht versuchte, sich für die Touristen schick zu machen. Jedes Mal, wenn er in seine Geburtsstadt zurückkehrte, brauchte er einige Tage, um sie wieder lieben zu lernen.
Lacydon hieß sein erster und einziger Gedichtband, den er Anfang der sechziger Jahre geschrieben und den ein Freund in Arles in einer winzigen Auflage herausgegeben hatte. Damals war er zweiundzwanzig gewesen. Es sollte eine Ode an Marseille, seine Geschichte, sein strahlendes Licht und seine redefreudigen Bewohner sein. Er hatte ein Dutzend Exemplare auf Flohmärkten verkauft und den Rest unter Freunden und Verwandten verteilt. Ein Karton mit dem Manuskript, das die ältere Schwester eines Freundes getippt hatte, stand immer noch unter seinem Bett, dazu fünf der schmalen, eleganten Bändchen.
Da es mit dem Dichten zunächst nichts wurde, nahm Monnier eine Anstellung als Lehrer für französische Literatur an einem Gymnasium in Aix-en-Provence an, bis sich erste literarische Erfolge einstellen würden. Eine betagte Großtante väterlicherseits vererbte ihm nach ihrem Tod die Wohnung im Quartier Mazarin der Stadt. Dort lebte er nach wie vor, umgeben von Reichtum: Unter ihm wohnten ein Graf und eine Gräfin, über ihm ein Architekt aus Paris. Hier stand er nun, pensioniert nach Jahrzehnten in diesem Job und an dieser Schule, ohne seine Gedichte noch einmal in Buchform gebracht zu haben. Er schrieb sie bis heute mit der Hand in gebundene Notizbücher, die er bei Michel auf dem Cours Mirabeau kaufte. Er wusste, dass die Verkäufer ihn hinter seinem Rücken le poète nannten, und es war ihm nicht unangenehm.
Als Monnier die Stadt mit einem Blick umfing, bekam er feuchte Augen. Den Hafen hatte er immer geliebt – die mittelalterlichen Festungen aus goldfarbenem Stein und die Abtei Saint-Victor, die ihm in ihrer wuchtigen Schlichtheit besser gefiel als die elegante Notre Dame de la Garde aus dem 19. Jahrhundert. Als er sich nach rechts wandte, sah er die Bunker, die die Deutschen im Zweiten Weltkrieg auf dem Hügel unterhalb des Pharo-Palais gebaut hatten. Als Jungen hatten sie dort gespielt, bis die Palastwachen sie vertrieben.
Mit der Entfernung des Bootes von der Küste weitete sich der Blick: Der private Schwimmklub unterhalb der Bunker kam in Sicht, wo man heute erst nach jahrelanger Wartezeit mit zahlreichen Empfehlungen Mitglied werden konnte, und in dessen Nähe das Dreisternerestaurant Passédat.
Jetzt wandte er sich von Marseille ab, nicht weil er die Stadt nicht mehr mochte, sondern um den Wind im Rücken zu haben. Beim dritten Versuch gelang es ihm tatsächlich, die Zigarre zum Glimmen zu bringen, wenn es auch nur ein paar kaum sichtbare rötliche Pünktchen an der Spitze waren. Er paffte heftig, damit sie nicht wieder ausging. Nun sah er, wie nahe sie bereits den Frioul-Inseln waren. Zu dieser Gruppe gehörte auch das jetzt verlassene Gefängnis-Eiland Île d’If, dem Alexandre Dumas mit dem Graf von Monte Christo ein Denkmal setzte. Zwei größere Inseln des Archipels waren durch einen Damm verbunden, wodurch ein großer, Marseille zugewandter Hafen entstand. Auch dort überall weiße Klippen und schroffe Kalkberge, auf denen hier und da grünes Gebüsch wuchs – in der Julisonne ein herrlicher Kontrast zur blaugrünen See. In seiner Jugend hatte ein Onkel (seine Mutter, Tochter italienischer Einwanderer, hatte elf Geschwister, sein Vater dagegen war ein Einzelkind) auf Frioul ein Strandhäuschen besessen, wo Eric und seine Cousins die Ferienwochen mit Schwimmen und Angeln verbrachten, oder mit Schreiben, wenn er allein war.
Weiter draußen wurden die Wellen größer. Mit einem dumpfen Schlag fiel das Boot in ein Wellental. Der Dichter hörte, wie ein älteres Paar, das vor ihm eingestiegen war, etwas rief, das wie »Hooray!« klang. Die Frau hatte den Schrei ausgestoßen. Sie stand mit dem Rücken zur Stadt und hielt sich mit weit ausgebreiteten Armen an der Reling fest, während ihr Mann komisch hin und her schwankte und nach einem festen Halt suchte, um ein Foto von ihr zu machen. Er trug weiße Tennisschuhe, die ihm zu groß zu sein schienen, und einen dieser seltsamen Mützenschirme gegen die Sonne – für Monnier ein ziemlich sinnloses Ding. Er wusste nicht, wie man diese Kopfbedeckung nannte, aber Leute, die so etwas trugen und »Hooray!« kreischten, konnten nur Amerikaner sein. Als die Frau bemerkte, dass Monnier sie musterte, lächelte sie ihm zu und rief: »Schwere See!« Monnier winkte mit seinem Panamahut zurück; sie hatte wohl etwas über die Wellen gesagt.
Er wollte nicht mehr so aufdringlich hinschauen; aber die Freude und die gemeinsame Begeisterung dieser Amerikaner hatten etwas Ansteckendes. Monnier hatte zwar Liebesaffären gehabt, war aber nie verheiratet gewesen. Die Frau, mit der er sein Leben hätte verbringen wollen, war vor fast fünfzig Jahren gestorben, und seitdem hatte ihn keine andere mehr interessiert. Das Dichten diente ihm als Vorwand, um für sich zu bleiben. Man glaubte ihm, denn etwas so Abstraktes konnten seine wenigen Freunde kaum verstehen.
Mit einer Woche auf der Insel wollte er sich für die vierzig Jahre belohnen, in denen er undankbaren (mit wenigen Ausnahmen) Siebzehnjährigen die Schönheit der Lyrik Flauberts hatte beibringen wollen. Als Beamter im Ruhestand erhielt er weiter sein volles Gehalt. Die 2000 Euro im Monat waren zwar nicht gerade üppig, aber völlig ausreichend für einen Mann, der mietfrei wohnte, keine Kinder hatte und kaum auf Reisen ging. Als er an seiner Zigarre zog, erblickte er sein Spiegelbild in einem Fenster des Bootes. Er sah wohl wirklich aus wie ein pensionierter Lehrer, der gern aß und trank und dabei nicht aufs Geld schaute. Eine Lesebrille mit halbmondförmigen Gläsern hing ihm ständig um den Hals, er hatte einen Bauch und trug weiße Guayaberahemden, die ihm eine Freundin von einem Besuch aus Kuba mitgebracht hatte (erst jetzt stellte er fest, dass dieses vom Abend zuvor mit Rinderragout bekleckert war). Kritisch betrachtete er seine rote Knollennase, den zottigen weißen Bart und das struppige graue Haar, das sich bereits lichtete.
Die Amerikaner waren damit beschäftigt, bei diesem Wellengang festen Halt zu finden. Monnier freute, dass die Sprachbarriere als Vorwand dienen konnte, sich nicht mit ihnen einlassen zu müssen, wenn sie erst einmal auf der Insel waren. Ohnehin kein besonders geselliger Mensch, suchte er dort Ruhe, Zeit zum Nachdenken und Schreiben. Da hörte er französische Laute.
Ein neues Paar tauchte auf seiner Seite des Bootes auf. Sie mussten bisher woanders gestanden haben und nach ihm und den Amerikanern eingestiegen sein. Sie waren jünger als jene und bestimmt zwanzig Jahre jünger als er selbst. Zumindest die Frau. Als sie an ihm vorübergingen, nickte er ihnen lächelnd zu, und sie taten es ihm gleich. Die Frau war groß und schlank, aber nicht mager; ihre üppigen kastanienbraunen Locken blies der Wind auf, wie es bei Élodie gewesen war. Sie hatte das Gesicht voller Sommersprossen, eine lange, schmale Nase, hohe Wangenknochen und schmale Lippen. Auch ihr Partner war beeindruckend, hatte aber nicht ihr klassisches Ebenmaß. Er war etwa so groß wie sie, eher ein wenig kleiner, hatte breite Schultern und bereits ein hübsches Bäuchlein. Auffallend war die gebrochene Nase – ein Unfall? Oder eine Sportverletzung? Sein dichtes schwarzes Haar war von ersten grauen Fäden durchzogen. Der Blick der Augen, die viel dunkler waren als ihre, wirkte intelligent. Er konnte herzlich lachen, wobei man sah, wie groß sein Mund war.
Monnier paffte seine Zigarre zu Ende und wandte sich wieder Marseille zu. Man konnte kaum noch Einzelheiten erkennen, nur Notre Dame de la Garde ragte auf einer Bergspitze östlich der Innenstadt empor – ein markanter Punkt wie Sacré Cœur in Paris, nur dass sich hier die Seeleute daran orientierten. Das Boot hatte inzwischen die Frioul-Inseln umrundet und hielt in südwestlicher Richtung aufs offene Meer zu. Sein Ziel war ein Eiland von nur 700 Metern Breite und zwei Kilometern Länge.
»Rauchen Sie eine kubanische?«, sagte da eine tiefe Stimme neben ihm. Es war der Mann mit der gebrochenen Nase und der schönen sommersprossigen Begleiterin.
»Was sonst?«, gab Monnier zurück. Er mochte nur ein kleiner Angestellter des öffentlichen Dienstes sein, aber er rauchte ausschließlich kubanische Zigarren. »Eine Upmann. Aber sie ist ausgegangen, und ich habe den Stummel nur noch im Mund, weil ich ihn nicht ins Wasser werfen will.«
»Ich habe auch eine Upmann in der Tasche«, antwortete der Mann und klopfte auf sein Leinenjackett, das selbst für Monniers ungeübtes Auge teuer wirkte. »Eine Magnum 46. Aber die hebe ich mir auf, bis wir auf der Insel sind. Meine Freundin hält es für albern, wenn ich hier auf...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.