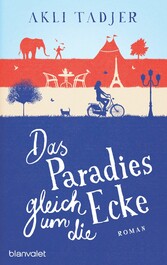Suchen und Finden
2
Im Hinterzimmer, das meinen Jungs als Küche und Ruhehafen dient, befinden sich eine Mikrowelle, das neueste Modell einer Kapsel-Kaffeemaschine, ein Kühlschrank, ein Regal, auf dem die Kleenex-Kartons für die Kummerfluten meiner Kunden stehen, ein Foto meiner Eltern, wie sie in ihrer Jugend stolz vor einem nagelneuen Leichenwagen posieren, und ein Stapel von Heften des Magazine funéraire, unseres Leichenbestatter-Fachjournals, die ich bereits gelesen habe und ohne besonderen Grund aufhebe. Außerdem ein einfacher weißer Holztisch, vier bequeme Stühle und, in der Ecke neben dem vergitterten kleinen Fenster, das auf meine Garagen hinausgeht, mein Sarg – ein Sully in total verschrammter Kastanie, der sich nicht mal als Sonderangebot losschlagen ließe und den ich zur Garderobe umgemodelt habe.
So viel zur »Ladenstube«.
Ach, ich vergaß, ansonsten stapeln sich da auch noch Kartons voller religiöser Symbole - Kruzifixe für die Christen, Halbmond und Stern für die Moslems, Davidsterne für die Juden - sowie künstliche Blumenbouquets und große Rollen mauvefarbener Bänder zum Schmücken der Kränze mit klassischen, aber immer noch beliebten Sprüchen wie: Du wirst immer in meinem Herzen sein. Ohne dich ist das Leben kein Leben. Ein Engel kehrt in den Himmel zurück. Oder solchen, die absichtlich eine gewisse Distanz zum Verstorbenen ausdrücken: Meinem Vater. Meiner Mutter. Meiner Großmutter. Meinem Großvater. Meinem Gatten. Meiner Gattin …
Kurzum.
Als ich gerade mein kleines Schwarzes aus- und meine Jeans anziehe, ruft mich meine große Schwester Rose an. Sie ist gerade auf Parkplatzsuche hier im Viertel, und da sie in einem Stau steckt, dessen Ende nicht abzusehen ist, unterhält sie sich ein bisschen mit mir. Zunächst erinnert sie mich noch einmal daran, dass wir in zwei Tagen den 11. Januar haben und ich dann dreißig werde. Was ich bestimmt nicht vergesse, denn seit einem Monat vergeht kein Tag, an dem sie mich nicht daran erinnert. Auch Leïla wurde von ihr gestern und vorgestern noch einmal daran erinnert. Und dann verkündet mir Rose, sie habe eine Dummheit gemacht, eine riesige und wunderschöne, die sie nicht länger für sich behalten könne.
Zur Feier des Tages habe sie die La Paloma gemietet, einen Kahn, der auf dem Canal de l’Ourcq am Quai de la Loire liegt. Sie habe schon alles organisiert, den Caterer, die Blumen, den Kuchen, sie werde sich sogar um den Empfang der Gäste kümmern. Ich hätte nichts weiter zu tun, als mich zu amüsieren und nach einem Verehrer Ausschau zu halten. Da sie so gut in Schwung ist, lege ich das Telefon auf den Tisch, stelle meine schwarzen Wildlederpumps auf das untere Bord in meinem Sarg und ziehe die Doc Martens an.
Dreißig.
Es ist mir vollkommen egal, dass ich dreißig werde. Schlimmer noch, ich hasse Geburtstage. Vor allem meinen. Er wirft mich in die Zeiten meiner Akne zurück, auf Erdnussflips und gezuckerte Kondensmilch. Dabei fingen meine Geburtstage immer gut an. Ich fand es schön, mit Rose und all den anderen Gästen das unverwüstliche »Happy Birthday« zu singen. Ich fand es schön, Geschenke zu bekommen, auch die, die ich nicht schön fand. Ich fand es schön, dass unsere Eltern zum Abendessen ins Restaurant gingen, damit wir die Wohnung für uns hatten. Ich fand es schön, dass wir, kaum hatten sie die Tür hinter sich geschlossen, über die Bar herfielen, um die angebrochenen Flaschen mit Whisky - oder sonst was, Hauptsache, es machte besoffen - zu leeren. Sobald uns der Alkohol hinreichend benebelt hatte, schoben wir Tisch und Stühle an die Wände, ich drehte die Musik auf volle Lautstärke, und dann tanzten wir Rock, Salsa oder Lambada. Wenn uns die Puste ausging, unsere Beine dem Rhythmus nicht mehr folgen konnten und uns der Schweiß auf die Stirn trat, dimmte ich das grelle Halogenlicht herunter, und Rose legte die Slows auf.
Das war der Moment, in dem für mich alles zu Asche wurde. Bei den ersten Takten umarmten sich die Paare, die sich bereits gefunden hatten, zärtlich. Andere, die sich zum ersten Mal begegnet waren, wiegten sich zunächst mit einem gewissen Abstand, dann näherten sich ihre Körper aneinander an, und noch bevor die letzten schmelzenden Töne des Slows verklungen waren, tanzten sie Wange an Wange; manche wagten sogar den ersten Kuss.
Ich stand inzwischen allein und ratlos am Buffet, stopfte mich mit allem Möglichen voll und wartete darauf, dass mich jemand an sich zog. Doch niemand hat sich mir je genähert.
Ganz anders Rose, sie war umschwärmt. Sie wusste, sie hatte ein hübsches Gesicht und einen nicht minder hübschen Hintern. Das machte ihr Spaß. Sie nutzte es aus. Wenn sie einen Typen im Auge hatte, oft den Hübschesten - oder Ordinärsten -, griff sie sich einen der Pfauen, der um sie herumparadierte, schleppte ihn mitten ins Wohnzimmer, stützte ihren Kopf auf seine Schulter und schmiegte sich an ihn, wobei sie ihre künftige Beute aber immer fest im Blick behielt. Bei den letzten zitternden Klängen des Slows versuchte ihr Anbagger-Gehilfe natürlich, sie zu küssen, doch sie machte sich scheinbar entrüstet von ihm los. Dann wandte sie sich dem hübschen Kerl zu, fuhr sich mit den Händen über das lange rote Haar, das ihr auf die zarten Schultern floss, und setzte zum krönenden Abschluss ihrer Charmeoffensive ihr rehäugiges Lächeln auf. Spätestens jetzt war der hübsche Kerl ins Herz getroffen und verloren.
Jahrelang war ich der Trostpreis für die abgewiesenen Loser, rachedurstig betatschten sie meinen Hintern oder versuchten, mir noch vor den ersten Takten des Slows einen Kuss zu rauben.
Einem dieser Typen, er war noch verklemmter als ich, habe ich schließlich nachgegeben, mein erstes Mal. Es war mein achtzehnter Geburtstag. Wir waren in meinem Zimmer, das Licht war aus. Er zog sich hastig den Reißverschluss runter, ich zog mich genauso schnell aus, wir fielen aufs Bett, er lag oben. Ich schloss die Augen, bewegte die Hüften und stöhnte, um Liebe vorzutäuschen. Wie ein Kaninchen erleichterte er sich in drei Stößen, zog sich wieder an und fragte stotternd: »Na, war’s gut für dich?«
Ich sagte … Nein, ich sagte gar nichts.
Er nahm seine Mokassins in die Hand und schlich sich wie ein Dieb auf Zehenspitzen aus meinem Zimmer. Ich taumelte zur Frisierkommode und starrte mich im Spiegel an: Ich fand mich hässlich wie immer, traurig wie so oft und außerdem zum Speien. Ich tuschte mir die Wimpern, besprengte mich mit Parfüm, um seinen Geruch nach nasser Wolle zu vertreiben, brachte mein Haar in Ordnung und sah dann zu, wie die mit Tränen vermischte Wimperntusche über meine blassen Wangen lief.
Wie er hieß?
Weiß ich nicht mehr.
Mein Gedächtnis hat ihn nicht behalten wollen.
Zu meinem neunzehnten Geburtstag lud Rose Étienne ein, sie kannten sich, weil sie beide Medizin studierten. Wie jedes Mal, wenn sie einen neuen Kerl anschleppte, war ich gelb vor Neid, denn mit den Jahren war sie immer verführerischer geworden und außerdem weit brillanter als ich, was Schule und Ausbildung anging. Wer uns nicht kannte, hätte nie gedacht, dass ich ihre Schwester sein könnte, höchstens ihre Freundin. Sie war alles, was ich gern gewesen wäre und nie sein würde. Wäre sie nicht meine Schwester gewesen, hätte ich mich in sie verknallt wie all die anderen auch, so viel ist sicher.
Étienne glich all ihren Exverehrern, nur in noch schöner. Er hatte breite Schultern, bräunliche Haut und zurückgekämmtes sehr schwarzes Haar wie Hugh Grant in Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Und er lächelte. Sein Gesicht war ein einziges Lächeln. Dazu hatte er eine tiefe, klangvolle Männerstimme, die mir eine Gänsehaut an den Armen verursachte, als er mir sagte, ich sei ebenfalls hübsch und meine Schüchternheit verleihe mir eine Aura des Geheimnisses, die meiner Schwester fehle. Ich glaubte ihm kein Wort, aber mir wurde ganz warm ums Herz, weil er einen ganzen Slow lang seinen wohlwollenden Blick auf mir ruhen ließ.
Wir hatten zu Joe Dassins L’Été indien getanzt. Diese alte CD meiner Eltern hatte ich heimlich aufgelegt, weil sie vier Minuten und zweiundzwanzig Sekunden lief. Etwas Längeres hatte ich in unserer Plattensammlung nicht finden können. Ich fühlte mich wohl in seinen Armen, und ich weiß noch, dass ich mich, sobald wir Wange an Wange tanzten, an ihn schmiegte wie Rose. Doch er blieb so ungerührt wie ein Steinblock. Zum x-ten Mal war ich voller Neid und Eifersucht auf meine Schwester, und zum x-ten Mal verwünschte ich meine Eltern dafür, dass sie mich so reizlos geschaffen hatten.
Vor allem meinem Vater war ich böse. Ich habe seinen wächsernen Teint geerbt, seine lange Nase und die schmalen Lippen, die mich immer so streng und grimmig wirken lassen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, musste ich auch noch seine sehr hellen, kleinen blauen Augen erben. Meine Mutter verglich ihr Blau gern mit dem der Südsee-Lagunen – und das gefiel mir, bis der Junge, der in der Schule neben mir saß, all meine Illusionen zerstörte, indem er ihr Blau mit dem des WC-Reinigers in der Entenhalsflasche verglich.
Zurück zu Étienne.
Nachdem Joe Dassin die letzten Zeilen und Schabadas abgeliefert hatte, legte ich Étienne den Kopf auf die Schulter und summte: »Et l’on s’aimera encore lorsque l’amour sera mort …«
Darüber hatte er erst lächeln müssen und dann offen gelacht, ein vulgäres, fettes Lachen aus vollem Hals, ein Lachen, das ihm gar nicht stand. Die Scham flammte über mein Gesicht. Er entschuldigte sich und...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.