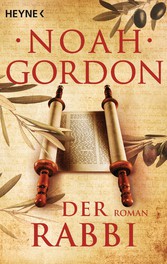Suchen und Finden
2
Als die Kinder ihn fragten, was die Mutter geschrieben habe, sagte er nur, es sei ein verspäteter Geburtstagswunsch gewesen. Es war kein Wink mit dem Zaunpfahl – oder vielleicht doch: Jedenfalls bestand anderntags das Resultat in einer selbst gezeichneten Glückwunschkarte Rachels und in einer gekauften von Max sowie in einer schreienden Krawatte von beiden; sie passte zu keinem seiner Anzüge, aber er trug sie an jenem Morgen im Tempel.
Geburtstage stimmten ihn optimistisch. Es waren Wendepunkte, wie er sich voll Hoffnung sagte. Der sechzehnte Geburtstag seines Sohnes fiel ihm ein – das war vor drei Monaten gewesen.
An diesem Tag hatte Max seinen Glauben an Gott verloren.
Sechzehn Jahre, das ist das Alter, mit dem man in Massachusetts einen Führerschein beantragen kann.
Michael hatte Max in seinem Ford Fahrunterricht erteilt. Die Prüfung war auf Freitag, den Vorabend seines Geburtstags, festgesetzt, und für den Abend des Samstags war er mit Dessamae Kaplan verabredet, einem Mädchen zwischen Kind und Frau, so blauäugig und rothaarig, dass Michael seinen Sohn um sie beneidete.
Sie wollten zu einer Tanzveranstaltung gehen, die in einer Scheune über dem See stattfand. Für den Nachmittag hatten Leslie und Michael ein paar Freunde ihres Sohnes zu einer kleinen Geburtstagsparty eingeladen, in der Absicht, ihm danach die Wagenschlüssel auszuhändigen, sodass er zum Geburtstag erstmals ohne elterliche Aufsicht fahren könne.
Aber am Mittwoch vorher war Leslie in ihre Depression verfallen und ins Krankenhaus gekommen, und Freitag vormittag hatte Michael erfahren, dass von baldiger Entlassung keine Rede sein könne. Hierauf hatte Max seinen Fahrprüfungstermin und auch die Party abgesagt. Als Michael aber hörte, dass Max auch Dessamae versetzte, meinte er, dass Einsiedlertum der Mutter nicht helfe.
»Ich mag nicht hingehen«, sagte Max einfach. »Du weißt doch, was am anderen Seeufer steht.«
Michael wusste es und redete Max nicht mehr zu. Es ist kein Vergnügen für einen Burschen, sein Mädchen am Wasser spazieren zu führen und drüben das Krankenhaus vor Augen zu haben, in das seine Mutter kürzlich eingeliefert worden war.
Den größten Teil des Tages verbrachte Max lesend im Bett. Dabei hätte Michael die üblichen Clownerien seines Sohnes gut brauchen können, weil er mit Rachel, die nach ihrer Mutter verlangte, nicht zurechtkam.
»Wenn sie nicht heraus darf, so gehen wir sie doch besuchen.«
»Das geht nicht«, sagte er ihr immer wieder. »Es ist gegen die Vorschriften. Jetzt ist keine Besuchszeit.«
»Wir schleichen uns hinein. Ich kann ganz leise sein.«
»Geh und zieh dich an zum Gottesdienst«, sagte er beschwichtigend. »In einer Stunde müssen wir im Tempel sein.«
»Daddy, es geht wirklich. Wir brauchen nicht mit dem Auto rund um den See zu fahren. Ich weiß, wo wir ein Boot finden. Wir können direkt hinüberrudern und Momma sehen, und dann fahren wir gleich wieder zurück. Bitte.«
Er konnte nichts tun, als ihr einen freundlichen Klaps hintendrauf geben und aus dem Zimmer gehen, um ihr Weinen nicht zu hören. Im Vorbeigehen warf er einen Blick in das Zimmer seines Sohnes.
»Mach dich fertig, Max. Wir müssen bald in den Tempel.«
»Ich möchte lieber nicht mitkommen, wenn du nichts dagegen hast.«
Michael sah ihn fassungslos an. Niemand in ihrer Familie hatte je, außer im Krankheitsfall, einen Gottesdienst versäumt.
»Warum?«, fragte er.
»Ich mag nicht heucheln.«
»Ich verstehe nicht, was du meinst.«
»Ich hab den ganzen Tag darüber nachgedacht. Ich bin nicht sicher, dass es einen Gott gibt.«
»Du meinst, Gott wäre nicht existent?«
Max sah seinen Vater an. »Vielleicht. Wer weiß das schon wirklich? Niemand hat je einen Beweis gehabt. Vielleicht ist er eine Legende.«
»Du glaubst also, ich hätte mehr als mein halbes Leben damit zugebracht, Schall und Rauch zu dienen? Ein Märchen fortbestehen zu lassen?«
Max antwortete nicht.
»Deine Mutter ist krank geworden«, sagte Michael, »und da hast du in deiner Weisheit dir ausgerechnet, dass es keinen Gott geben kann, denn Er hätte das nicht zugelassen.«
»Stimmt.«
Dieses Argument war nicht neu; Michael war nie imstande gewesen, es zu widerlegen, und er wollte es auch nicht. Ein Mensch glaubt entweder an Gott, oder er glaubt nicht.
»Dann bleib zu Hause«, sagte er. Er wusch Rachels gerötete Augen und half ihr beim Anziehen. Als sie wenig später das Haus verließen, hörte er eben noch, wie Max auf seiner Harmonika einen Blues zu gellen begann. Für gewöhnlich unterließ es sein Sohn aus Achtung vor dem schabbat, am Freitagabend zu spielen. An diesem Abend aber konnte Michael es gut verstehen. Wenn es wirklich keinen Gott gab, wie Max argwöhnte, wozu sollte er sich länger an das sinnlose Gekritzel auf dem Totempfahl halten?
Michael und Rachel waren die Ersten im Tempel, und er öffnete alle Fenster in der Hoffnung auf einen leichten Windhauch. Als Nächster kam Billy O’Connell, der Organist, und dann Jake Lazarus, der Kantor. Jake verschwand wie üblich sofort auf der Herrentoilette, kaum dass er sich in seinen schwarzen Talar gekämpft und das Käppchen aufgesetzt hatte. Dort blieb er immer genau zehn Minuten, beugte sich über die Waschmuschel und sah in den Spiegel, während er seine Stimmübungen machte.
Der Gottesdienst war für halb neun angesetzt, aber bis dahin hatten sich nur sechs weitere Gläubige eingefunden. Fragend blickte Jake den Rabbi an.
Michael bedeutete ihm zu beginnen: Gott sollte nicht auf die Saumseligen warten müssen.
In den nächsten fünfunddreißig Minuten kamen noch einige Leute, und schließlich waren es siebenundzwanzig – er konnte sie von der bema aus leicht zählen. Er wusste, dass einige Familien auf Urlaub waren. Er wusste auch, dass er auf den Kegelbahnen im Umkreis zumindest einen minjen hätte finden können, dass an diesem Abend zahlreiche Cocktailpartys stattfanden und dass sich zweifellos mehr von seinen Gemeindemitgliedern in Sommertheatern, Klubs und chinesischen Restaurants aufhielten als hier im Tempel.
Vor Jahren hätte es ihm wie ein Messer ins Herz geschnitten zu sehen, dass nur eine Handvoll seines Volkes in die Synagoge gekommen war, um den schabbat zu grüßen. Nun aber hatte er schon seit Langem gelernt, dass für einen Rabbi auch schon ein einziger Jude als Gefährte beim Beten genug ist; er war in Frieden mit sich selbst, als er den Gottesdienst für eine kleine Gruppe von Leuten hielt, die kaum die ersten beiden Bankreihen füllten.
Die Nachricht von Leslies Erkrankung hatte sich herumgesprochen, wie sich solche Dinge immer herumsprachen, und während des oneg schabbat, des geselligen Beisammenseins nach dem Gottesdienst, machten einige der Damen viel Aufhebens um Rachel. Michael war dankbar dafür. Sie blieben lange, begierig nach der schützenden Nähe der Herde.
Als sie heimkamen, brannte bei Max kein Licht mehr, und Michael störte ihn nicht.
Der Samstag verlief wie der Freitag. Wie gewöhnlich war der schabbat ein Tag der Ruhe und der Besinnung, aber dieser brachte den Kinds keinen Frieden. Jeder war auf seine Art mit seinem Kummer beschäftigt. Kurz nach dem Abendessen erhielt Michael die Nachricht, dass Jack Glickmans Frau gestorben war. Er musste also noch einen Kondolenzbesuch abstatten, obwohl er die Kinder an diesem Abend nur sehr ungern allein ließ.
»Willst du noch ausgehen?«, fragte er Max. »Dann bestelle ich einen Babysitter für Rachel.«
»Ich habe nichts vor. Mach dir keine Sorgen um sie.«
Später erinnerte sich Max, dass er nach dem Weggehen des Vaters sein Buch beiseitegelegt hatte und auf dem Weg ins Badezimmer in Rachels Zimmer geschaut hatte. Es war kaum dämmrig, aber sie hatte sich schon zu Bett gelegt, das Gesicht zur Wand.
»Rachel«, sagte er leise, »schläfst du?« Da sie nicht antwortete, ließ er es dabei bewenden und schlich hinaus. Er nahm sein Buch wieder auf und las weiter, bis er etwa eine halbe Stunde später nagenden Hunger verspürte. Auf dem Weg in die Küche sah er nochmals in Rachels Zimmer.
Das Bett war leer.
Er vergeudete fünf Minuten Zeit, sie im Haus und im Hof zu suchen; er rief nach ihr und wagte nicht, an den See und an das Boot zu denken, nicht an ihren Wunsch hinüberzurudern, geradewegs in die Arme ihrer Mutter. Er wusste nicht einmal, ob es das Boot wirklich oder nur in ihrer Fantasie gab – aber er wusste, dass er so schnell wie möglich zum See kommen musste. Sein Vater war mit dem Wagen unterwegs, und so blieb Max nichts als das verhasste Fahrrad. Er holte es von den zwei rostigen Nägeln an der Garagenwand herunter und bemerkte dabei mit Zorn und zugleich mit Angst, dass Rachels Rad nicht an seinem üblichen Platz neben dem Rasenmäher stand. Dann fuhr er, so schnell er treten konnte, durch die feuchte Augustnacht. Das Haus lag kaum achthundert Meter vom Deer Lake entfernt, aber als er das Ufer erreichte, war er in Schweiß gebadet. Von der Straße, die rund um den See führte, konnte man das Wasser auch bei Tag nicht sehen; es lag verborgen hinter Bäumen. Aber da gab es noch einen schmalen Fußpfad am Ufer entlang; der war ausgewaschen und mit Wurzeln verwachsen, mit dem Rad unmöglich befahrbar. Max versuchte es bis zu dem Platz, wo er Rachels Rad fand: Er sah die Rückstrahler im Mondlicht aufleuchten – und da stand es, säuberlich an einen Baum gelehnt, direkt neben dem Weg; er ließ sein Rad daneben ins Gras fallen und rannte zu Fuß weiter.
»RACHEL?«, rief er.
Grillen zirpten im Gras, und das Wasser schlug an die Felsen. Im bleichen Mondlicht blickte Max...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.